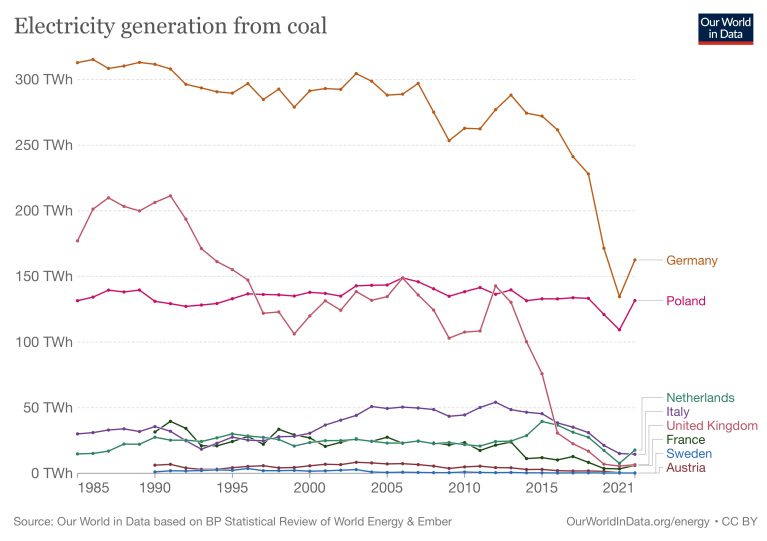Seit den frühen Nullerjahren spielt die Stromproduktion aus erneuerbaren Energiequellen eine immer größere Rolle. Zuletzt (2021) wurden etwa 40% des gesamten Stroms aus erneuerbaren Quellen hergestellt . Der Zuwachs der Erneuerbaren ist dabei derzeit noch zu langsam, um die klimaschädliche Kohle schnell aus dem Netz zu verdrängen.
Kohle – größter Klimakiller
Mehr als ein Drittel der weltweiten CO2-Emissionen stammen aus der Verbrennung von Kohle. In der EU sind Kohlekraftwerke für rund ein Fünftel aller Treibhausgase verantwortlich. Es ist völlig klar: Ohne einen Kohleausstieg sind die Klimaziele nicht erreichbar. Die Erwärmung des globalen Klimas wird nicht auf unter zwei Grad begrenzt bleiben, wenn weiterhin Kohle verbrannt wird.
Braunkohle ist mit einem Kohlenstoffdioxidausstoß von 1.093 Gramm pro Kilowattstunde erzeugtem Strom (CO2/kWhel) der klimaschädlichste aller Energieträger. Auch die Steinkohle erreicht noch einen sehr hohen Wert von 1.001 Gramm. Bei der Verstromung von fossilem Erdgas entstehen dabei nur 422 Gramm CO2/kWhel. Fossiles Erdgas ist dennoch sehr kritisch zu sehen, da bei der Produktion, der Lagerung oder dem Transport oft nicht unerhebliche Teile davon entweichen. Fossiles Erdgas besteht allerdings zu einem großen Teil aus Methan, dessen Klimawirksamkeit über 20 Jahre etwa 85 mal höher ist als die von CO2. Der einzige echte Ersatz für Kohle kann daher nur ein Verbund aus erneuerbaren Energien sein.
Zwar konnten die CO2-Emissionen pro Kilowattstunde durch Verbesserungen der Effizienz einzelner Kraftwerke in den letzten Jahrzehnten leicht gesenkt werden, doch ist die Kohleverstromung weiterhin aus Klimaschutzsicht unverantwortlich. Die diskutierte Technik der Abscheidung von Kohlendioxid aus Kohlekraftwerken ist sozial und ökologisch höchst bedenklich. „Sauber“ würden die Kraftwerke durch das Verfahren nicht. Mehr zur CO2-Abscheidung, auch als CCS bezeichnet, lesen Sie weiter unten.
Umwelt- und Gesundheitsschäden durch Kohle
Während die Energiekonzerne mit der Kohle Milliardengewinne einfahren, trägt die Gesellschaft den größten Teil der Folgekosten für Umwelt- und Gesundheitsschäden. Gesundheitliche Probleme verursacht die Kohleverstromung unter anderem durch die Emission von Schadstoffen wie Ruß, Schwefeldioxid und Schwermetallen, vor allem Quecksilber. Auch radioaktive Substanzen wie Uran, Thorium und ihre Zerfallsprodukte werden bei der Kohleverstromung freigesetzt. Über fünf Tonnen Quecksilber gelangen über deutsche Kohlekraftwerke pro Jahr in die Luft, das sind etwa zwei Drittel des gesamten deutschen Ausstoßes.
Hochproblematisch ist auch die Braunkohleförderung. Die Tagebaue zerstören nicht nur Natur und Landschaft, sondern auch jahrhundertealte Dörfer. Sie sind verantwortlich für die zwangsweise Umsiedlung zigtausender Menschen. Ganze Regionen werden auf einer Tiefe von bis zu einem halben Kilometer (Tagebau Hambach) geradezu umgegraben, denn die Abraum- und Materialbewegung eines Tagebaus beträgt im Durchschnitt das Fünffache der geförderten Braunkohle. Die Tagebaue bewirken dabei eine Vielzahl von ökologischen, gesundheitlichen, kulturellen und finanziellen Folgeschäden. Sie führen zu Verlusten von Artenvielfalt, zerstören Ökosysteme und erzeugen Lärm- und Feinstaubbelastungen.
In aktiven Tagebauen wird das Grundwasser mit Tiefbrunnen bis unter die Kohleschichten abgepumpt, damit Großgeräte sicher stehen. Die Grundwasserabsenkung kann dabei mehrere Kilometer ins Umfeld des Tagebaues wirken und zu Konflikten mit der regionalen Trinkwasserversorgung, zum Absterben von Bäumen, zur Vernichtung von Feuchtgebieten oder zu Setzungsschäden an Gebäuden aufgrund der Senkung des Bodens führen.