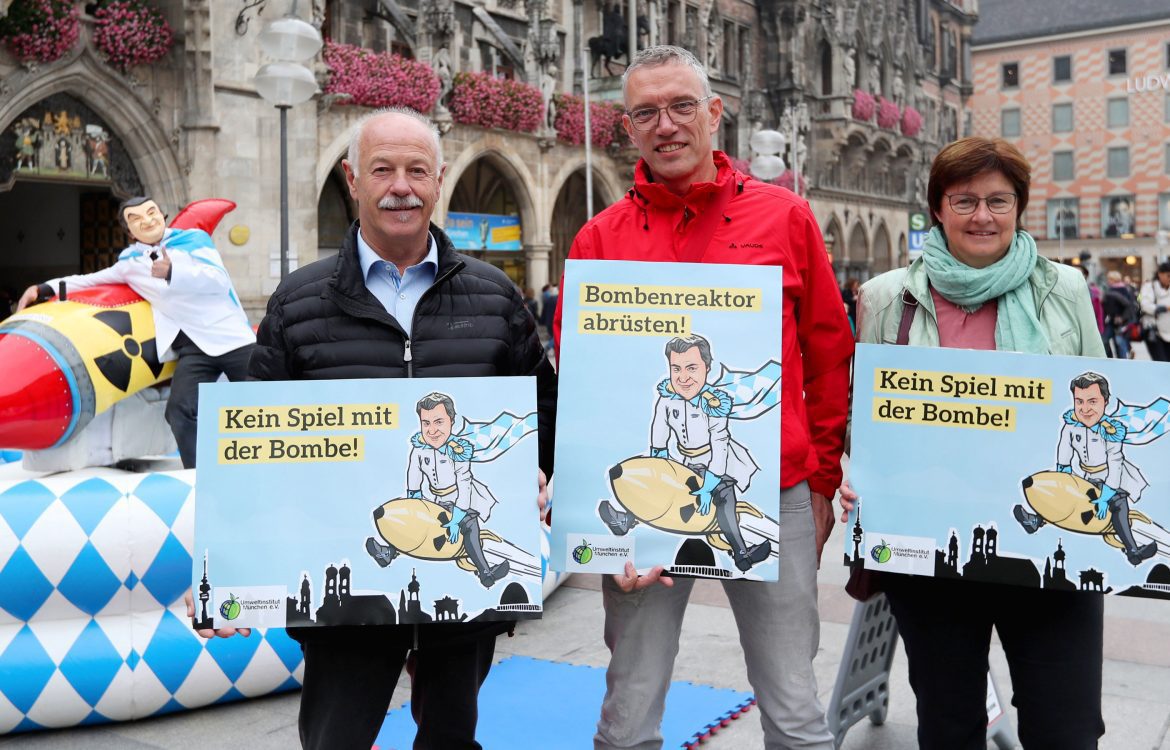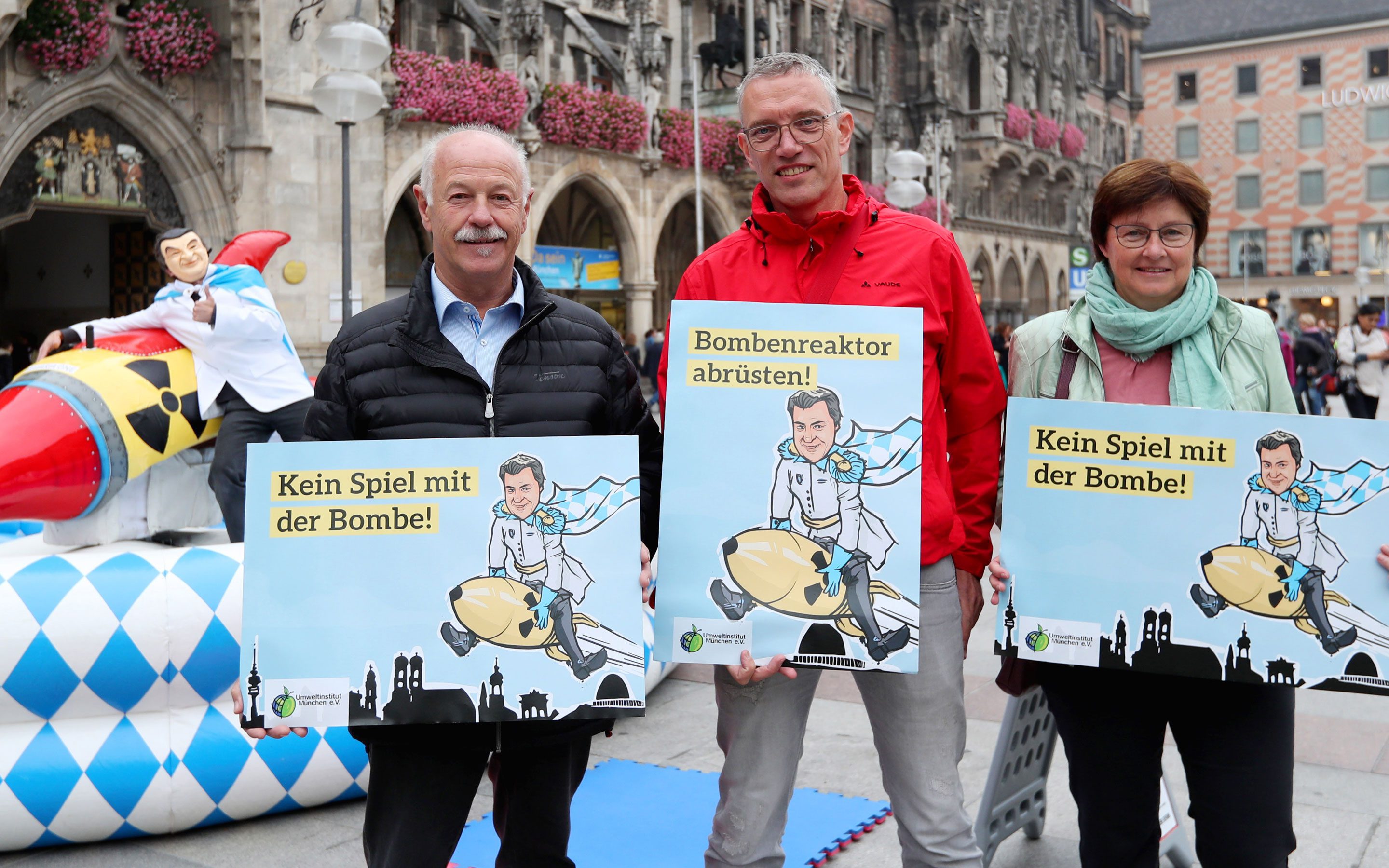Der Garchinger Reaktor missbraucht weltweite Abrüstungbemühungen
Die Entwicklung des neuen hochdichten Brennstoffs war ein Erfolg. Weltweit wurden viele Forschungsreaktoren, die bisher mit HEU arbeiteten, auf niedrig angereichertes Uran (LEU, Lowly Enriched Uranium) umgestellt.
In Deutschland stellten zwei Forschungsreaktoren ihre Brennstoffversorgung um: FRG I Geesthacht und BER II Berlin. Bei Reaktoren, die in absehbarer Zeit stillgelegt würden, wurde auf eine Umrüstung verzichtet, so z.B. für den FRJ II Jülich, der 2006 abgeschaltet wurde. Nach der Inbetriebnahme des Forschungsreaktors Orphee (Saclay, Frankreich) im Jahr 1980 war der FRM II der erste nennenswerte Forschungsrektor, der mit HEU in Betrieb ging. Planungen gab es darüber hinaus in China, Libyen, Russland. Mit einem zu 27 Prozent angereichertem HEU Brennstoff soll der Jules Horowitz Reactor in Frankreich Ende der 2020er Jahre in Betrieb gehen.
Der Garchinger Sonderweg besteht darin, dass die Reaktorplaner der TU München den speziell für die Verwendung von LEU in Forschungsreaktoren entwickelten Brennstoff hoher Dichte mit Uran hoher Anreicherung kombinierten, also zweckentfremdeten. Seit den ersten HEU-Plänen für den Garchinger Reaktor (1988) gab es Bestrebungen, den FRM II abzurüsten. Die USA haben sich seit 1989 bemüht, die TU München zur Umplanung ihres neuen Reaktors auf LEU zu bewegen und Hilfestellung angeboten. Auf nationaler Ebene war man sich 1988 noch einig, dass neue Forschungsreaktoren nur noch mit LEU ausgerüstet werden.
Sobald der neue hochdichte Brennstoff mit niedriger Anreicherung entwickelt war und zur Verfügung stand, entschied sich die TU München dafür, diesen Brennstoff mit Uran hoher Anreicherung zu kombinieren, um technisch weltweit an der Spitze zu sein. Unter diesen Umständen waren die USA nicht bereit, HEU für den FRM II zu liefern und nahmen dies 1992 mit dem sogenannten Schumer Amendment in die nationale Gesetzgebung auf. Es besagt, dass HEU nur noch an Reaktorbetreiber geliefert werden darf, die einer Umrüstung auf LEU zugestimmt haben oder wenn eine Umrüstung derzeit nicht möglich ist.